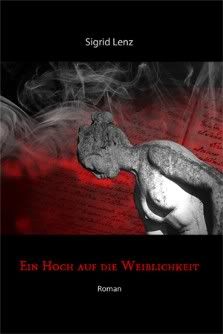Was Sie noch niemals über Slasherinnen wissen wollten und auch jetzt nicht zu fragen wagen
Aus dem schonungslosen Offenbarungsbericht 'Maja - Geschichte einer Slasherin' die erste und absolut authentische Leseprobe:
Achtung - unsterbliches Werk - ich hab doch deutlich gewarnt - copyright: aavaa verlag (aber ich bin mir ziemlich sicher, Auszüge posten zu dürfen ... und wenn nicht - verklagt mich doch ...)
*
Diese Beleidigung meiner Lieblings-TV-Serie konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen und holte bereits Luft zum Gegenschlag, als sich Xavers Stirn auf einmal in Falten verzog. Sein Gesicht nahm den Ausdruck an, den ich nur aus Momenten kannte, in denen er über seinen Textaufgaben brütete.
„Also“, sagte er langsam und betont. „Du hast nicht nur Menschen aus fremden Ländern gesehen, sondern auch noch geheimnisvolle Sicherheitskräfte. Und du fürchtest, sie könnten etwas mit dir zu tun haben.“
„Es tut mir leid“, murmelte ich kleinlaut.
„Das sollte es auch. „Sein strafender Blick traf mich erbarmungslos. “Entweder dreht deine Phantasie völlig mit dir durch und du siehst Gespenster…“ Er stockte. „Mehr Gespenster als gewöhnlich.“ Eine seiner Augenbrauen wanderte in die Höhe. „Oder finstere Mächte suchen dich heim, um Rache zu nehmen für deine Internet-Untaten.“
Ich schluckte, doch wehrte ich mich. „Das sind keine Untaten. Das ist Befreiung und… und Befreiung eben…“
„Wehe, wenn sie losgelassen…“, stöhnte Xaver wieder. „Ehrlich. Ich hab keine Ahnung, was du meinst, aber offensichtlich musst du schleunigst damit aufhören.“ Hoffnung flackerte in seinem Blick. „Und etwas Vernünftiges tun. Etwas Sinnvolles. Etwas, das ich auch in der Schule erzählen kann.“ Er schob die Unterlippe vor, und ein hysterisches Kichern brach sich aus mir Bahn.
„Es tut mir leid“, wiederholte ich und knuffte ihn in die Seite. „Ich reiß mich zusammen.“ Ich überlegte. „Das bedeutet, ich werde erst einmal darüber schreiben.“ Erleichtert atmete ich auf, froh eine momentane Lösung entdeckt zu haben.
„Na doll“, grummelte der Junge in sich hinein und wühlte in seiner Schultasche. Doch kaum hatte er seinen Gameboy in den Fingern, ließ ihn ein Aufschrei seiner Mutter zusammenzucken.
„Verdammt.“ Der Bildschirm flackerte, doch das war nicht die Ursache meines Unmutes. Obwohl mein Sorgenkind, der Computer sich wie üblich mühsam und lautstark aus seinem Schönheitsschlaf aufrappelte, sich stotternd einige Momente weigerte und zierte, so ließ er sich doch eigentlich rasch und problemlos hochfahren und ermöglichte mir den Zugang zu der Welt, die mein ein und alles war. Doch mein Fluch hatte einen Grund und der lag nicht nur in der überquellenden Mailbox.
Ein schlechtes Zeichen, fürwahr. Ließ ich doch die zahlreichen Kommentare zu meinen Werken nicht mehr direkt in meinen Briefkasten senden, sondern bemühte mich, die Korrespondenzen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Ein Zugeständnis, das dem kreativen Genius erlaubt werden sollte. Ein Zugeständnis, das vielleicht mein Ego weniger streichelte, da ich weniger Feedback, weniger Lob und Ermunterung seitens abhängiger Leser erhielt. Aber das Opfer war eine Notwendigkeit, hemmte doch jede Zeitverschwendung den Fluss des Schaffens. Ergo war es kein Wunder, dass ich beim ungewohnten Anblick der Anzahl von Nachrichten erschrak. Noch weniger verwunderlich war es, dass ich in regelrechte Panik geriet, als sich mir die Absender jener Nachrichten offenbarten. Das Unheil ließ sich zwar nicht auf eine Person zurückführen, jedoch auf die Bewegung, deren Wort- und Rädelsführer diese Person war. Wie um alles in der Welt war sie an meine E-Mail Adresse geraten? Womit in aller Welt hatte ich das verdient.
Schon seit geraumer Zeit machte sie mir das Leben schwer, verwässerten ihre penibel ausgedrückten, vernichtend konservativen Kommentare meinen Lesern den Kunstgenuss. Schon seit geraumer Zeit kämpften meine Online Anhänger auf virtuellem Grunde gegen die giftigen Säuren, die sich den Weg durch ihren Netzanschluss in die unschuldige Gemeinschaft der Freunde romantischer Literatur bahnten.
Natürlich war es eben diese Romantik, die dieser Dame ein Dorn im Auge war. Diese Romantik, die ihrem verknöcherten Gemüt den Brechreiz entlockte, dem sie verbalen Ausdruck verlieh.
Doris van Karnten, extremistisches Fangirl der Jahrtausendserie ‚Agents on Fire‘. Sie leitete nicht nur einen Fanclub, sondern gleich mehrere. Sie organisierte Foren, Conventions, Petitionen und Aktionen verschiedenster Färbungen und Ziele. Sie betrieb einen Fanshop, produzierte Briefpapier, Ansichtskarten, Wallpaper und Banner mit den Helden des kleinen Bildschirms.
Mit meinem Helden, dem blonden Star der Serie: Finn Cackleford. Ich will nicht behaupten, dass ich ihn mehr liebte, als sie es tat. Ich will auch nicht behaupten, dass ich das einzig wahre Recht auf die Auffassung des Charakters besaß, den er so gekonnt und genial verkörperte. Ich behaupte allerdings, dass mir das Recht zusteht, meine Auffassung der Dinge zu veröffentlichen, gleichgesinnten Seelen so die Möglichkeit zu verschaffen, ein Forum für ihre einsamen Fantasien zu entdecken, sich nicht alleine zu fühlen mit dem, was sich im tiefsten Inneren ihrer Seele, in den verbotenen, verschlossenen Kerkern versteckte.
War es denn falsch zu träumen? War es falsch von Romantik zu träumen in einer Welt, die so vollkommen frei von Romantik ist? Und diese Welt war frei von Romantik. Es war die harte Welt der Geheimdienste. Eine knallharte Welt, dominiert von Gewalt und Hass. War es nicht umso entzückender, ausgerechnet in dieser Welt die zarte Pflanze der Liebe erblühen zu lassen, zwei Seelen zu vereinen, die so verschieden, so weit voneinander entfernt und doch so nah waren.
Natürlich, sie waren beide Kollegen, meine Agenten. Ein Job, eine Berufung, ein Ideal. Und sie beide waren Männer. Zwei Männer, die sich liebten.
Natürlich nicht in der Serie. Nicht auszudenken in einer amerikanischen Mainstream Produktion. Nicht auszudenken, eine Idee wie diese der texanischen Landbevölkerung zuzumuten.
Aber hier, im freien Europa, in einem freien Land, in der freien Phantasiewelt einer Frau? Nein, nicht einer Frau alleine. Tausende teilten meine Vision. Tausende sahen in dem wöchentlichen Geplänkel, den Macho-artigen Streitereien unter tapferen Kriegern gegen das Böse, nur ein Vorspiel für etwas Größeres, etwas Wahrhaftiges, für die echte Liebe, wie sie es nur zwischen zwei gleichgestellten Kerlen geben kann. Kämpfend um Dominanz, kämpfend um die Macht, kämpfend für ein abstraktes Ziel, das sensible Gemüter kaum interessierte. Der Kampf dagegen, erschwert durch persönliche Schicksalsschläge, Dramen und Seelenqualen – er konnte nur zu einer Lösung, zu einem Höhepunkt führen. Zu der absoluten Hingabe an den einzigen Menschen, der Halt und Stütze gewährleisten konnte. Und in Finn Cacklefords Welt, besser gesagt, in der seines Charakters, konnte es das Ersehnte nur in einem Menschen geben. In dem großen, dunkel gelockten Angelo Multobene, seinen Partner, seinen Mitstreiter, seiner Deckung.
Und in den Gefilden der Slash-Literatur, seines Geliebten.
Heimlich lasen sie es; heimliche Leidenschaften flammten auf bei der Vorstellung der beiden ach so männlichen Figuren, im immerwährenden Clinch. Ungebrochen seelisch und körperlich verstrickt in immerwährender Umschlingung der heißen Leiber, vereint in dem ewigen Tanz, suchend nach Ekstase, verlangend nach Erfüllung, wissend um die Unmöglichkeit ihres Begehrens.
Slash macht frei. Der Slash verschönert den grauen Alltag, Slash hält Existenzen wie die meine am Leben. Slash vertreibt die Langeweile und die Enttäuschung. Er öffnet Pforten, enthüllt Geheimnisse, erlaubt Entdeckungen. Der Slash ist die Krone der Fanliteratur.
Doch dann gab es sie. Menschen, anonyme Gesichter, die es nicht ertragen konnten, wenn ihre Helden anders handelten, anders liebten, als es in ihrer verklemmten Gemütswelt möglich sein durfte. Selbst wenn es nur in der Phantasie einer einzelnen Person geschah. Und all diese gesichtslosen Menschen kumulierten in einer Figur, Doris van Karnten. Doris, weizenblond gefärbt, hager von Gestalt, besessen von der Reinheit des heldenhaften Agenten. Besessen von der selbstgewählten Aufgabe, die Beschmutzer jener Reinheit bloßzustellen, sich an ihnen zu rächen, sie zu vernichten.
Und vor allen anderen, die die Welt anders sahen als sie selbst, hatte sie mich auf ihrem Kieker. Vielleicht, weil ich deutsch schrieb und sie daher wohl eher zufällig auf meine beleidigenden Geschichten gestoßen war. Vielleicht, weil ich die Einzige war, die es wagte, auch in unserer so kalten, harten Muttersprache die Charaktere der Serie auszuleihen, um sie unmenschlichen Torturen zu unterziehen. Vielleicht auch nur, weil ich es war, weil ich für sie erreichbar war, weil sie mich gefunden hatte. Weil sie mich jetzt gefunden hatte. Es musste etwas zu tun haben mit dieser ID, IP Nummer, die hin und wieder und vollkommen unverständlich für technisch und logisch unbegabte Geister wie mich erwähnt wird. Ich wusste, dass ich mehr Vorsicht hätte walten lassen sollen, dass eine erfundene Identität, ein abgedrehter Künstlername einfach nicht ausreichte. Grob fahrlässig, so hatte ich gehandelt, anders ließ es sich nicht erklären.
Ich starrte auf die Absender. Sie war es. Unverkennbar ihre Mailadresse. Unverkennbar der Account ihrer Fangemeinschaft. Es war… all diese Hasstiraden trugen ihre Handschrift. Es reichte aus, die Betreffzeilen zu lesen, um sich dessen klar zu werden. Es reichte, sich ein wenig in den Gebieten, in den Räumen der Fangemeinschaften herumgetrieben zu haben. Und ihre Anhänger hatten es ihr gleichgetan. Mein Briefkasten quoll über. Mein Geheimnis war gelüftet.
Trotz des Pseudonyms, unter dem ich schrieb, trotz der Vorsichtsmaßnahmen, die ich so gewissenhaft getroffen hatte, war meine Anschrift durchgesickert.
Ein beängstigender Verdacht breitete sich in mir aus. Mein Kopf fuhr herum, und ich starrte Xaver erschrocken an. Er blickte zurück, mindestens ebenso verwirrt, doch glücklicherweise noch ohne den Ernst der Lage zu erkennen. Glückliches Kind.
Ich stürmte an ihm vorbei. Ich riss die Tür auf. Zu spät kam mir die Unvorsichtigkeit dieser Handlung zu Bewusstsein. Doch noch spielte diese keine Rolle. Niemand bedrohte mich. Noch nicht. Niemand mit Ausnahme der Papiere, der Massen von Papieren, die aus dem Briefkasten neben der Tür quollen. Niemand außer den zahllosen Briefen, die verziert mit Totenköpfen und gestempelt mit Galgenmännchen und abstrakten Zeichnungen von tödlichen Waffen, eine eindeutige Botschaft des Inhalts lieferten, den anzusehen, ich nicht mehr den Nerv hatte.
Automatisch, als könnte ich mich nicht zurückhalten, als wollte ich mich selbst quälen, griff ich mit beiden Händen in die weiße Flut, packte, wessen ich habhaft werden konnte, und zog mich mit dem letzten Aufflackern der einstigen Selbstkontrolle wieder zurück in den Schutz der Wohnung.
Xaver starrte mich mit großen Augen an, und ich konnte es ihm nicht verdenken.
„Was… was ist denn los?“, stammelte er, auf einmal nicht mehr der junge Mann, der er so gerne wäre, sondern das unsichere Kind, das dem in mir verborgenen so ähnlich war.
Erst jetzt merkte ich, dass ich zitterte. „N… nichts…“, stotterte ich und versteckte die Briefe hinter meinem Rücken.
Doch Xaver war nicht umsonst in diversen für mich unverständlichen Ballsportarten zuhause. Obwohl ich alles getan hatte, um ihm beizubringen, dass Sport Mord sei und jede Bewegung unweigerlich zum Ende aller Lebenskraft führte, war es ihm doch gelungen, sich die Tricks der Sportler zu eigen zu machen, die ihren Ball aus der Hand des Gegners zaubern konnten, ohne, dass es besondere Anstrengung kostete. Natürlich konnte ich mich selbst auch nicht als ernsthaften Gegner bezeichnen. Demnach war es eigentlich kein Wunder, dass er mir die Handvoll Papiere entwinden konnte, bevor ich überhaupt etwas davon bemerkte. Jedoch seinen Gesichtsausdruck bemerkte ich sehr wohl.
„Was zum Teufel…?“
Er sah mich an. „Stirb du Schlampe!“
„Wie bitte?“ Ich merkte, wie ich rot anlief.
„Na… steht da.“ Er wies mit ausgestrecktem Zeigefinger auf einen Umschlag, dessen rote Flecken bei genauerem Hinsehen, als kunstvoll verschnörkelte Blutstropfen zu erkennen waren.
Die Farbe wich wieder aus meinem Gesicht und ich spürte, wie meine Knie schwach wurden.
„Das… das ist bestimmt nur ein Scherz.“
„Ach ja?“ Xaver hielt mir einen grimmigen Totenkopf entgegen.
„Der hier auch?“ Er schüttelte den Kopf.
„Mensch, Mama. Diesmal hast du dir aber wirklich Feinde gemacht.“
„Ich weiß doch auch nicht, wie die an meine Adresse gekommen sind… ich… ich kann nichts dafür.“
Der kühl wissende Gesichtsausdruck Xavers belehrte mich eines Besseren.
„Und mir sagen, ich solle die Verantwortung für meine Fehler übernehmen. Pah!“
„Das… ich hab keine Fehler gemacht“, versuchte ich meine angekratzte Autorität wieder aufzurichten.
Xander lachte blechern. „Nein, nur Millionen anständiger, harmloser Krimifans so gekonnt vor den Kopf gestoßen, dass ihnen nichts Besseres einfällt, als dein Leben zu bedrohen.“
„Die… die bedrohen mich doch nicht… das können die doch nicht.“
„Also ich bezweifle das.“ Xaver ließ die Umschläge zu Boden flattern und durchquerte rasch den Raum, um sich über den Monitor zu beugen.
Ein Klick. „Und was ist das?“, schnappte er und begann zu buchstabieren, stoppte jedoch abrupt, als ihm die Bedeutung des Wortes aufging. Er lief rot an und das sollte wahrhaftig etwas bedeuten. War mein Söhnchen doch kein unbeschriebenes Blatt, wenn es darum ging, die Tiefen des Wortschatzes auszuloten. Ich selbst zog es vor, meinen Blick vom Monitor abzulenken und geflissentlich auf das Finn Cackleford Poster zu starren, das ich über dem Fernseher befestigt hatte. Es war das, auf dem er in lässig cooler Pose gegen einen Pferdezaun lehnte, im Einklang mit Natur und Weite der Landschaft. Ein Bild, das ich als gute Mutter also auch meinem Sohn zumuten konnte, ohne ihn fürs Leben zu schädigen.
Die Promo-Poster, auf denen Finn mit gezogener Pistole über Häuserdächer sprang, oder in schusssichere Weste gekleidet mit einem Messer zwischen den Zähnen und einer blutenden Wunde auf der Stirn, sich heldenhaft vor seinen bedrohten Partner warf, hatte ich wohlweislich in den Schrankinnentüren angebracht. Kam ja gar nicht in Frage, dass meine Begeisterung irgendwelche seltsam erscheinenden Züge annahm. Davon, einen Altar aus Zeitungsschnipseln zu basteln, war ich noch weit entfernt. So hoffte ich zumindest.
„Mama… hey!“ Xavers Finger schnippten knapp vor meinem Gesicht und weckten mich aus meiner Trance.
„Was… was ist denn los?“
„Was los ist?“ Xaver raufte sich die ohnehin schon struppigen Haare. „Was los ist?“, wiederholte er schrill. „Los ist, dass Wahnsinnige aus der Anstalt ausgebrochen sind und dir nun auflauern. Du hast nicht nur Indianer beleidigt, sondern auch noch ‚Agents on Fire‘–Fans.“
Ich verzieh ihm die aus einem momentanen Schock heraus geborene politische Unkorrektheit. „Was für eine Anstalt?“ Immerhin fand ich mich langsam wieder zurecht und verschränkte die Arme vor der Brust. „Hier gilt immer noch die Meinungsfreiheit… gerade im Internet.“
„Das denkst du vielleicht“, protestierte Xaver. „Aber du bist auch die Einzige, die es wagt, die Grenzen des guten Geschmackes wieder und wieder zu überschreiten und die Empfindsamkeit fremder Kulturen mit Füßen zu treten.“
„Amerikanische Ureinwohner hatten keine Angst vor Homosexualität“, warf ich ein und bereute mal wieder, dass ich meinem Sohn von Anfang an beigebracht hatte, auch rhetorisch seinen Mann zu stehen. Eigentlich hatte ich ihn schon in der Wiege ohne Punkt und Komma zugetextet. Er hatte keine andere Wahl, als sich so schnell wie möglich mit den Waffen, die ich ihm in die Hand gegeben hatte, zur Wehr zu setzen.
„Ganz im Gegenteil.“ Ich setzte zu einem Vortrag an. „Krieger zogen Stärke daraus, in der Nacht vor der Schlacht bei einem Mann zu liegen, der…“
Xaver hielt sich verzweifelt die Ohren zu. „Ich weiß, ich weiß. Und ich will es gar nicht wissen“, jammerte er gequält.
„Aber das ist doch das Schlimme“, fuhr ich enthusiastisch fort. Was sonst sollte ich auch tun, als mich auf vertrautem Gelände von der aktuellen Bedrohung fortzubewegen. „Das Schlimme, wenn sogar ihr jungen Leute eine solche Angst und Scham empfindet, wenn ihr nur das Wort schwul…“
„Lalalala…“ Xaver presste seine Hände nur noch fester gegen seinen Kopf und verdrehte die Augen. „Hab doch Erbarmen, Mama. Nicht jeder will von morgens bis abends nur über Das Eine sprechen.“
„Aber…“
Ein flehender Blick brachte meine Überzeugung ins Wanken, und ich beschloss, den Aufklärungsunterricht auf einen anderen Tag zu verschieben. Am Besten auf einen Tag, an dem ich nicht das Gefühl haben musste, eingekesselt von meinen Feinden im Inneren einer abgeschotteten Schlucht auf den Einmarsch der Armee zu warten. Einer Armee, die ausgezogen war, meine Person und alle Spuren ihrer Existenz von der Bildfläche zu wischen.
„Ist ja gut.“ Ich tätschelte ungelenk sein wirres Haar. „Ich bin schon still.“
Xaver ließ die Hände herabsinken und grinste schief. „Noch mal davon gekommen“, murmelte er und machte eine ungenaue Handbewegung, die sowohl die Briefe, als auch den Computer, sowie alles, was sich vor der Wohnungstür befand, einschloss. „Und was machen mir damit?“
Ich presste die Lippen zusammen und senkte den Kopf.
Rational denken, das war jetzt wichtig. Gut, Doris war eine Verrückte, doch wie weit würde sie wirklich gehen. Und wie viel von all dem ging letztendlich auf ihr Konto? Schließlich waren da noch die Indianer, die amerikanischen Ureinwohner, verbesserte ich mich im Stillen. Es war einfach traurig, dass sich alte Gewohnheiten und Ausdrücke so schwer abgewöhnen ließen.
Wie groß war die Gefahr wirklich? Und inwieweit war Xaver betroffen? Der Gedanke bohrte sich heiß in meine Eingeweide. Dass ich daran nicht früher gedacht hatte. Egal welchen Gefahren ich mich für meine Ideale aussetzen würde, es war alles andere als fair, meinen Jungen mit hinein zu ziehen.
Xavers Augenbrauen hatten sich prüfend zusammengezogen. Seine braunen Augen musterten mich aufmerksam.
„Mama? Was brütest du jetzt schon wieder aus“, fragte er argwöhnisch.
„Nichts, nichts“, beeilte ich mich zu versichern. „Ich brüte nichts aus, das würde ich nie.“
„Natürlich.“ Xaver rieb sich die Stirn. „Also was… von nun an immer auf der Flucht?“ Er sah sich um. „Ich meine, wir können nicht leugnen, dass das Ganze etwas unschön Bedrohliches annimmt.“
„Auf der Flucht? Wie meinst du das?“, erkundigte ich mich, das Schlimmste befürchtend.
„Na der Film“, stöhnte Xaver auf. „Immer auf der Flucht vor der Fangemeinde deiner Serie?“
„Ha!“ Ich versuchte spöttisch zu klingen, doch heraus kam lediglich ein erbärmlich weinerlicher Laut, der zudem noch halb in meinem Halse stecken blieb. Es würde doch nicht das erforderlich sein, wovor ich mich am meisten fürchtete? Es würde doch nicht…
*